Glück und Last der Erstgeborenen
Erstgeborene, „Sandwichkinder“ und Nesthäkchen – die Geschwisterkonstellation beeinflusst und formt Menschen. Kinder werden – in Abhängigkeit der Position innerhalb des Familiengefüges – unterschiedlich geprägt, fühlen sich mit verschiedenen Erwartungen und Anforderungen konfrontiert und nehmen sich anders wahr. Doch was sind – generell betrachtet – die Vor- und Nachteile der Erstgeborenen?
Die ungeteilte Aufmerksamkeit
Das erstgeborene Kind kommt zur Welt – das bedeutet für die meisten Eltern das Ende einer langen Phase der Vorbereitung und des Wartens auf das Kind. Es bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe zu spüren und kann zunächst rund um die Uhr von den Eltern versorgt werden. Eventuell sind die frischen Eltern im Umgang mit ihrem Baby zunächst auch noch etwas unsicher, auf jeden Fall ist jeder noch so kleine Entwicklungsschritt für sie etwas Neues, etwas bisher noch nie Erlebtes. Die kleinen Entwicklungsschritte werden stolz beobachtet und gefeiert und mit sehr viel Aufmerksamkeit bedacht.
Das erstgeborene Kind kommt zur Welt – das bedeutet für die meisten Eltern das Ende einer langen Phase der Vorbereitung und des Wartens auf das Kind. Es bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe zu spüren und kann zunächst rund um die Uhr von den Eltern versorgt werden. Eventuell sind die frischen Eltern im Umgang mit ihrem Baby zunächst auch noch etwas unsicher, auf jeden Fall ist jeder noch so kleine Entwicklungsschritt für sie etwas Neues, etwas bisher noch nie Erlebtes. Die kleinen Entwicklungsschritte werden stolz beobachtet und gefeiert und mit sehr viel Aufmerksamkeit bedacht.
Die Entthronung
Wird nun ein zweites Kind geboren, haben die erstgeborenen Kinder oft mit dem Verlust der Aufmerksamkeit, die sie bis dahin alleine genießen konnten, schwer zu kämpfen. Eifersucht auf das neue Baby äußert sich auf verschiedenen Wegen: Aggressionen gegen den vermeintlichen „Eindringling“, Schwierigkeiten beim Einschlafen, Bettnässen oder anderes auffälliges Verhalten können direkte Folgen sein. Auch als Erwachsene haben Erstgeborene oft noch unter diesem kindlichen Schmerz zu leiden, der sich bis dahin in verschiedenen Formen manifestiert haben kann. Es ist schwer, das Kind vor dieser oft ersten tiefen Frustration zu beschützen, doch können spezielle Aufmerksamkeit und je nach Alter des Kindes auch Gespräche helfen, die Situation positiv zu gestalten.
Wird nun ein zweites Kind geboren, haben die erstgeborenen Kinder oft mit dem Verlust der Aufmerksamkeit, die sie bis dahin alleine genießen konnten, schwer zu kämpfen. Eifersucht auf das neue Baby äußert sich auf verschiedenen Wegen: Aggressionen gegen den vermeintlichen „Eindringling“, Schwierigkeiten beim Einschlafen, Bettnässen oder anderes auffälliges Verhalten können direkte Folgen sein. Auch als Erwachsene haben Erstgeborene oft noch unter diesem kindlichen Schmerz zu leiden, der sich bis dahin in verschiedenen Formen manifestiert haben kann. Es ist schwer, das Kind vor dieser oft ersten tiefen Frustration zu beschützen, doch können spezielle Aufmerksamkeit und je nach Alter des Kindes auch Gespräche helfen, die Situation positiv zu gestalten.
Das große Kind, das schon alles kann
Da erstgeborene Kinder naturgemäß durch den Altersvorsprung den jüngeren Geschwistern in den zu erwerbenden Fähigkeiten und der Entwicklung im Regelfall voraus sind, bekommen sie hierfür oft den Stolz und die Bestätigung der Eltern zu spüren. Jedoch wird den Großen oft auch schon deutlich mehr zugemutet und sie werden mit sehr viel mehr Pflichten belastet – wichtig ist es hier darauf zu achten, den Kindern im Gegenzug auch mehr Rechte oder Privilegien einzuräumen.
Aber auch die Jüngeren können von den bereits erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ihrer älteren Geschwister profitieren. Diese könnten beispielsweise ihren kleinen Geschwistern beibringen, sich die Schuhe zuzubinden oder sich anzuziehen. In erster Linie lernt dadurch natürlich das jüngere Kind etwas, doch laut verschiedener Forschungen fördert dieses „Lehren“ die älteren Kinder ebenfalls deutlich.
Da erstgeborene Kinder naturgemäß durch den Altersvorsprung den jüngeren Geschwistern in den zu erwerbenden Fähigkeiten und der Entwicklung im Regelfall voraus sind, bekommen sie hierfür oft den Stolz und die Bestätigung der Eltern zu spüren. Jedoch wird den Großen oft auch schon deutlich mehr zugemutet und sie werden mit sehr viel mehr Pflichten belastet – wichtig ist es hier darauf zu achten, den Kindern im Gegenzug auch mehr Rechte oder Privilegien einzuräumen.
Aber auch die Jüngeren können von den bereits erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ihrer älteren Geschwister profitieren. Diese könnten beispielsweise ihren kleinen Geschwistern beibringen, sich die Schuhe zuzubinden oder sich anzuziehen. In erster Linie lernt dadurch natürlich das jüngere Kind etwas, doch laut verschiedener Forschungen fördert dieses „Lehren“ die älteren Kinder ebenfalls deutlich.
Den Weg für die Geschwister ebnen
Auch für die Eltern ist das große Kind in einer Familienkonstellation oft das erste Kind, auch sie müssen also ihre eigenen Grenzen in punkto Erziehung ein erstes Mal abstecken. Gerade bei jugendlichen Erstgeborenen führt das oft zu recht großen Konflikten und einem rebellischeren Verhalten als bei den jüngeren Kindern. Sie merken, dass für die Eltern vieles noch neu ist: wie viel Taschengeld soll gezahlt werden, wie lange dürfen die Jugendlichen außer Haus bleiben etc.
All diese Themen müssen ausgelotet werden. Somit wird für die jüngeren Kinder dieser Kampf oftmals schon mitgekämpft: Wenn die gleichen Themen bei den Jüngeren aktuell werden, ist die Position der Eltern zu diesem Thema schon genauer definiert und sie haben Vergleichs-möglichkeiten.
Auch für die Eltern ist das große Kind in einer Familienkonstellation oft das erste Kind, auch sie müssen also ihre eigenen Grenzen in punkto Erziehung ein erstes Mal abstecken. Gerade bei jugendlichen Erstgeborenen führt das oft zu recht großen Konflikten und einem rebellischeren Verhalten als bei den jüngeren Kindern. Sie merken, dass für die Eltern vieles noch neu ist: wie viel Taschengeld soll gezahlt werden, wie lange dürfen die Jugendlichen außer Haus bleiben etc.
All diese Themen müssen ausgelotet werden. Somit wird für die jüngeren Kinder dieser Kampf oftmals schon mitgekämpft: Wenn die gleichen Themen bei den Jüngeren aktuell werden, ist die Position der Eltern zu diesem Thema schon genauer definiert und sie haben Vergleichs-möglichkeiten.
Großer Bruder, große Schwester
Nicht unwesentlich ist natürlich auch die Geschlechterkonstellation. Hier findet Rivalität oft anders statt und die Kinder stehen in einem anderen Kontrast zueinander. Ältere Jungen fallen vor allem für jüngere Schwestern oft in eine Beschützerrolle, während ältere Schwestern ihre jüngeren Brüder tendenziell eher bemuttern. Meist ist die Rivalität vor allem ab dem Alter von drei Jahren deutlich geringer, wenn das zweite Kind nicht das gleiche Geschlecht hat wie das erste Kind.
Nicht unwesentlich ist natürlich auch die Geschlechterkonstellation. Hier findet Rivalität oft anders statt und die Kinder stehen in einem anderen Kontrast zueinander. Ältere Jungen fallen vor allem für jüngere Schwestern oft in eine Beschützerrolle, während ältere Schwestern ihre jüngeren Brüder tendenziell eher bemuttern. Meist ist die Rivalität vor allem ab dem Alter von drei Jahren deutlich geringer, wenn das zweite Kind nicht das gleiche Geschlecht hat wie das erste Kind.
Ich denke, dass es für Eltern sehr wichtig ist, sich mit den Gegebenheiten, die die Kinder aufgrund der Familienposition erleben, auseinanderzusetzen und sich dieser bewusst zu werden. Zum einen können vielleicht einige „Fehler“ vermieden oder mögliche Probleme minimiert werden, zum anderen können so auch die Vorzüge, die sich aus den verschiedenen Positionen ergeben, genutzt werden. Nicht zuletzt können aber auch viele Eltern so etwas über sich selbst und ihre eigene kindliche Prägung lernen.
Die Autorin Juliane Schneider ist Studentin der Afrikawissenschaften und hat schon im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet














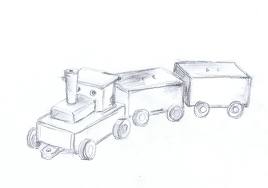 Dies
betrifft auch den Einsatz von Medikamenten, welcher immer von
psychotherapeutischen Massnahmen begleitet werden sollte. Viele Studien
belegen, dass eine Behandlung mit Medikamenten die Wirkung der
psychotherapeutischen Maßnahmen oftmals deutlich verstärken kann.
Selbstverständlich wird die Kindertherapie in der Regel ohne Medikamente
durchgeführt, insbesondere wenn diese nicht notwendig sind oder der
Patient diese ablehnt. Aber auch wenn die Indikation für eine Medikation
ärztlich gesehen wird sollt Als Kinder- und Jugendpsychiater und
-psychothere dies nur ein Angebot darstellen und keinesfalls erzwungen
werden. Die Aufgabe von Therapeuten ist es Behandlungsangebote zu machen
und Wege zu finden, um an der bestehenden Problematik weiter zu
arbeiten und das Ziel der Normalisierung im Auge zu behalten, auch wenn
Widerstände auftreten.
Dies
betrifft auch den Einsatz von Medikamenten, welcher immer von
psychotherapeutischen Massnahmen begleitet werden sollte. Viele Studien
belegen, dass eine Behandlung mit Medikamenten die Wirkung der
psychotherapeutischen Maßnahmen oftmals deutlich verstärken kann.
Selbstverständlich wird die Kindertherapie in der Regel ohne Medikamente
durchgeführt, insbesondere wenn diese nicht notwendig sind oder der
Patient diese ablehnt. Aber auch wenn die Indikation für eine Medikation
ärztlich gesehen wird sollt Als Kinder- und Jugendpsychiater und
-psychothere dies nur ein Angebot darstellen und keinesfalls erzwungen
werden. Die Aufgabe von Therapeuten ist es Behandlungsangebote zu machen
und Wege zu finden, um an der bestehenden Problematik weiter zu
arbeiten und das Ziel der Normalisierung im Auge zu behalten, auch wenn
Widerstände auftreten.